Wer Abwechslung zur Apfelschorle sucht, findet neben anderen Basisfrüchten wie Quitte, Johannisbeere, Kirsche oder Birne auch Obstsorten, mit denen sich die Äpfel zu neuen Geschmacksvarianten zusammentun: Dazu gehören Exoten wie Granatapfel oder Grapefruit. Aronia, Holunder oder Heidelbeeren geben dem Gemisch eine kräftigere Farbe und einen Touch von Superfood. Ingwer- und Rote-Bete-Beimischungen heben die Schorle ebenfalls in die Superstarliga.
Alternative zu Limo
Damit aus Saft eine Schorle wird, muss er einfach mit Wasser und Kohlensäure gemischt werden. Entweder ist einfaches Trink- oder Tafelwasser die Grundlage oder qualitativ höherwertiges natürliches Mineralwasser oder sogar Bio-Mineralwasser. Schorle gilt als natürliche Alternative zu Limonade. Im Vergleich zu Bio-Limonade liefert sie prinzipiell weniger Zucker und mehr Frucht und eher Frucht statt Auszüge und Aromen, also mehr Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.
Konventionelle Limo wird schon mal mit zehn Prozent Zucker produziert, aber auch mit Süßstoffen gesüßt. Ihnen werden zudem oft Zusatzstoffe wie Mineralstoffe, Vitamine und Farbstoffe beigemischt. Bei Bio-Limo liegt der Zuckergehalt zwischen 7 und 8, bei Schorle zwischen 2,4 und 8 Gewichtsprozent, das entspricht theoretisch zwischen einem und sieben Würfelzucker in einer 250-Milliliter-Portion. Praktisch ist das aber nicht dasselbe. Denn Limonade darf zusätzlich mit Haushaltszucker oder etwa Traubenkonzentrat gesüßt werden, Schorle nur in Ausnahmen, bei sehr sauren oder intensiven Früchten.
Schorle enthält fast immer nur fruchteigene Süße. Das ist gut, weil sie im natürlichen Verbund mit anderen Inhaltsstoffen daherkommt. Zuviel davon verursacht jedoch bei Menschen mit Fruktoseunverträglichkeit Bauchschmerzen und kann sich auf Dauer negativ auf die Gesundheit auswirken. Insbesondere in Kombination mit Säure birgt Frucht- genauso wie Kristallzucker zudem eine Gefahr für den Zahnschmelz.
Mehrweg ist Trumpf
Schorle ist ein typisches Mitnahme-Getränk. Standard ist im Biohandel die Mehrweg-Glasflasche. Aus Umwelt-Perspektive sind laut Naturschutzbund
Mehrweg-Glasflaschen, die nur regional unterwegs sind, derzeit eine der besten Lösungen. Das gilt auch für die ebenfalls im Naturkosthandel kursierenden Mehrweg-PET-Flaschen, die bei längeren Transportwegen wegen ihres niedrigeren Gewichts Punkte sammeln.





















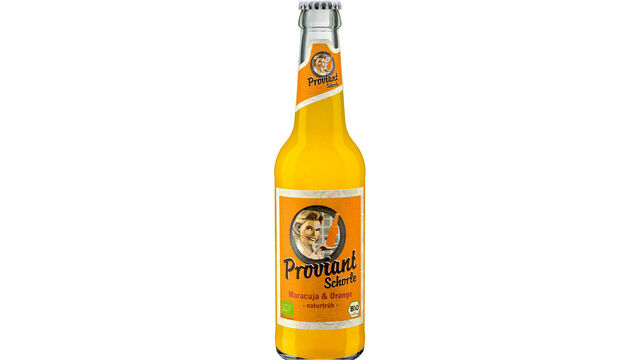



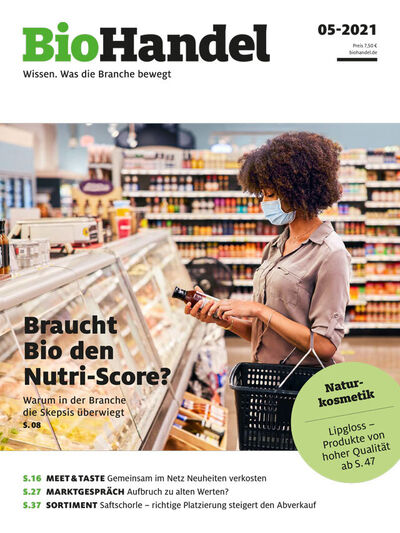
Kommentare
Registrieren oder anmelden, um zu kommentieren.